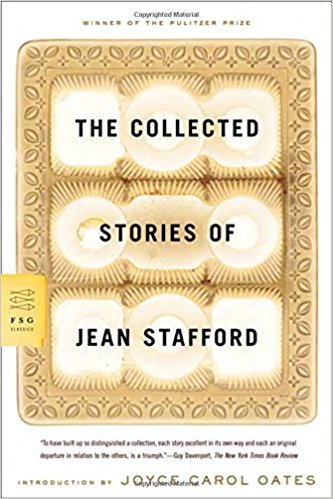Ihr kostbarstes Organ
Sven Hensel hat auf seinem Blog den Mai als Monat der Autorinnen ausgerufen. Fast wäre diese schöne Aktion an mir vorübergegangen. Aber nun greife ich den Hashtag auf und möchte eine Autorin vorstellen, die ziemlich in Vergessenheit geraten ist, von der ich aber nicht genug schwärmen kann: Jean Stafford.
Die US-Amerikanerin Jean Stafford wurde 1915 im kalifornischen Covina geboren und starb 1979 in White Plains, New York. Ihr Privatleben wurde wohl durch zwei unglückliche Ehen, Esstörungen, Alkoholmissbrauch und Depressionen geprägt. Doch sie schrieb drei Romane – Boston Adventure (1944), The Mountain Lion (1947) und The Catherine Wheel (1953) – und zahlreiche Erzählungen, die in Zeitschriften wie dem New Yorker, Vogue oder Harper’s erschienen. Für die Geschichte „In the Zoo“ erhielt sie 1955 den O.-Henry-Preis und für ihre Collected Stories 1970 den Pulitzer-Preis. Stafford weigerte sich, literarischen Strömungen zu folgen, sodass ihre Werke, schreibt Ann Hulbert in einer Biografie, „anachronistic in the best sense“ wirken.
Ins Deutsche übersetzt
In Deutschland ist Stafford kaum bekannt. In den 1960er-Jahren wurde ein Teil ihrer Werke von Elisabeth Schnack übersetzt in einem Schweizer Verlag veröffentlicht, als Die Geschwister (1958), Das Katharinenrad (1959), Ein Wintermärchen und andere Erzählungen (1960) und Klapperschlangenzeit (1965). Diese sind heute jedoch bestenfalls noch antiquarisch zu finden.
The Interior Castle
Genauer vorstellen möchte ich hier meine liebste Kurzgeschichte: Mit „The Interior Castle“ von 1946 habe ich mich sowohl für ein Übersetzungsseminar als auch für meine Masterarbeit beschäftigt, sodass ich sie zeitweise fast auswendig kannte. Trotzdem ist sie mir nie auf die Nerven gegangen. Mit einem Blick auf das Porträtfoto und Staffords Nasenform ist es vielleicht interessant anzumerken, dass die Erzählung auf einem biografischen Erlebnis beruht. Gemeinsam mit dem Dichter Robert Lowell hatte sie nämlich einen Autounfall – als Ursache kann man wohl seine Raserei und zu viel Alkohol vermuten. Dabei wurde ihre Nase so stark verletzt, dass die Heilung extrem schmerzhaft und langwierig war. Eine andere Biografin, Charlotte Margolis Goodman, schildert, wie Stafford im Krankenhaus eine lokale Betäubung statt Vollnarkose bekam und vor Schmerzen fast vom Operationstisch springen wollte.
Teresa von Ávila
In „The Interior Castle“ heißt die Operierte nicht Jean Stafford, sondern Pansy Vanneman, aber die Schilderung der Atmosphäre und der Schmerzen ist so genau, so eigenwillig und empathisch, dass ich diesen biografischen Zusammenhang herzustellen wage.
Der Titel der Erzählung ist ein Verweis auf das Werk Castillo interior von Teresa von Ávila, einer spanischen Mystikerin aus dem 16. Jahrhundert. Teresa von Ávila war keine dogmatische Theoretikerin, sondern schrieb in einem recht leicht zugänglichen Stil von ihren Visionen, aber auch von Unsicherheiten in Bezug auf ihren Glauben und die Möglichkeiten, diesen Glauben auszudrücken. Dabei halfen ihr Metaphern und Vergleiche: „It came to me that the soul is like a castle made exclusively of diamond or some other very clear crystal“, und diese innere Burg gelte es zu erforschen, um Erleuchtung zu erlangen. Natürlich schrieb sie nicht auf Englisch, aber da ich leider kein Spanisch kann, muss die englische Ausgabe herhalten, die ja auch Jean Stafford als Referenz hatte.
Ihr kostbarstes Organ
Der Patientin Pansy Vanneman geht es dabei allerdings nicht um ihre Seele, die in dieser Burg haust, sondern um ein konkretes, kostbares Körperorgan: ihr Hirn.
Not only the brain as the seat of consciousness, but the physical organ itself which she envisaged, romantically, now as a jewel, now as a flower, now as a light in a glass […]. It was always pink and always fragile, always deeply interior and invaluable.
Pansys Gegenspieler, derjenige, der ihr sozusagen ans Hirn will, ist der Chirurg. Dr. Nicholas.
Dr. Nicholas, young, brilliant, handsome, was an aristocrat, a husband, a father, a clubman, a Christian, a kind counselor, and a trustee of his preparatory school. Like many of the medical profession, even those whose specialty was centered on the organ of the basest sense, he interested himself in the psychology of his patients.
Es erfüllt ihn mit „melancholy pleasure“, wenn er sich vorstellt, wie lebendig und zuversichtlich Pansy vor ihrem Unfall wohl war. Seine eigene Nase ist natürlich „magnificent“, nicht einmal er selbst hätte sie perfekter gestalten können. Als er Pansy im Gespräch sagt, er kenne einen guten plastischen Chirurgen, lehnt sie mit einem vagen Lächeln ab. Seine Reaktion: „He […] hoisted a manly shoulder and said „You’re the doctor“.“ Voller Selbstvertrauen – „he had brought his craft to its nearest perfection“ – und Eifer – „[h]is shapely hands ached for their knives“ – geht er an die schwierige Operation heran und scherzt beschwingt mit seiner „entourage of white-frocked acolytes“ und vor allem seiner Krankenschwester, sie müsse wohl aus Kanada sein, dort, wo alle so höflich sind, weil sie ihn wiederholt „sir“ nennt. Nach dem selbstverständlich erfolgreichen Eingriff schwebt er wie ein großer Cäsar aus dem Raum – „he was leaving, adjusting his coat with an air of vainglory, and the interne, abject with admiration, followed him […], smiling like a silly boy“.
Halbgott in weiß
Geballt wirkt diese Ironie vielleicht übertrieben, doch im Text entfaltet sie genau die richtige Wirkung, denn das Bild des Halbgotts in weiß wird ständig gebrochen. Pansy, die wie das Stiefmütterchen, dessen Namen sie trägt, stets zurückhaltend bleibt, sieht ihn nämlich durchaus so, wie er wirklich ist, und nennt ihn sogar einmal „blunderer“. Wenig später fährt er die OP-Schwester an, sie solle einen Schritt zurücktreten: „I’m at this girl’s brain and I don’t want my elbow jogged“ – dabei weiß er genau, dass Pansy ihn hören kann und leicht in Panik geraten kann. Seine männliche Großartigkeit wird auch nicht unbedingt dadurch bewiesen, wenn er ihr vermeintlich tröstend sagt, er selbst würde sich ja lieber ein Bein brechen, als solch eine Nasenoperation durchstehen zu müssen. Als er eine Pause macht, versucht er noch einmal, Vertrautheit herzustellen – die Pansy allerdings gleich zurückweist.
„There. It won’t be much longer. I’ll tell them to send you some coffee, though I’m afraid you won’t be able to taste it. Ever drink coffee with chicory in it? I have no use for it.“
She snatched at his irrelevancy and, though she had never tasted chicory, she said severely, „I love it.“
Dr. Nicholas chuckled. „De gustibus. Ready? A pack, Miss Kennedy.“
„A pack“ bezieht sich übrigens auf eine in Kokainlösung getränkte Tamponade, die er Pansy in ein Nasenloch schiebt. Er warnt sie, dass es „disagreeable“ werden könne, aber eine kurze Unannehmlichkeit sei doch auszuhalten.
In such pain as passed all language and even the farthest fetched analogies, she turned her eyes inward, thinking that under the obscuring cloak of the surgeon’s pain she could see her brain […].
But none of the others in the room could see inside and when the surgeon was finished, the nurse at the foot of the bed said, „Now you must take a look in the mirror. It’s simply too comical.“ And they all laughed intimately like old, fast friends.
Der freundliche Onkel
Zum Schluss lobt Dr. Nicholas seine Patientin noch wie ein freundlicher Onkel: „The surgeon, squeezing her arm with avuncular pride, said, „Good girl,“ as if she were a bright dog that had retrieved a bone.“
Pansy jedoch verspürt nichts als Hass auf ihn. Einen kurzen, wunderbaren Moment lang ist es ihr zwar gelungen, ihre Augen so ruhig nach innen zu kehren, dass sie ihr Hirn erblickt:
It was a pink pearl, no bigger than a needle’s eye, but it was so beautiful and so pure that its smallness made no difference. Anyhow, as she watched, it grew. It grew larger and larger until it was an enormous bubble that contained the surgeon and the whole room within its rosy luster.
Doch gleich ist dieser Augenblick wieder vorbei; sie ist vollkommen erschöpft und hat das Gefühl, dass Dr. Nicholas in sie eingedrungen und ihre innere Burg, ihr rosa schimmerndes Diamantenhirn verletzt und gestohlen hat. Sie sind ein Dieb, brüllt sie ihm stumm entgegen, Sie sind herzlos und sollten zum Tode verurteilt werden! „She closed her eyes, shutting herself up within her treasureless head.“
Stop! Stop!
Neben des außergewöhnlichen Inhalts einer Nasenoperation begeistert mich auch Staffords Sprache. Wie sich Schmerz anfühlt, weiß schließlich jede – aber wie kann man ihn beschreiben? In Worte fassen? Stafford nutzt zum Beispiel viele Parallelkonstruktionen und phonetische Besonderheiten, mit denen Sie eine poetische Wirkung erzielen.
Um die Schmerzen zu vergessen, erinnert Pansy sich an ihre Kindheit und verschiedenfarbige Jahreszeiten:
There was a green spring when early in April she had seen a grass snake on a boulder, but the very summer that followed was violet, for vetch took her mother’s garden. She saw a swatch of blue tulle lying in a raffia basket on the front porch of Uncle Marion’s brown house.
Ich bin linguistisch und phonetisch leider nicht so bewandert, dass ich dafür die richtigen Fachbegriffe kenne, aber hier ziehen sich die Gleichklänge durch die Sätze, beispielsweise der [tch]-Endlaut in „vetch“ und „swatch“, der wiederkehrende [b]- und [v]-Anlaut, die [u]-Laute in „blue tulle“ oder die vielen [o]s am Satzende.
Noch ein Beispiel, einfach weil ich mich frage, wie lang Stafford wohl an einem solchen Abschnitt gefeilt hat:
There was a rush of plunging pain as he drove the sodden gobbet of gauze high up into her nose and something bitter burned in her throat […]. He returned to her with another pack, pushing it with his bodkin doggedly until it lodged against the first. Stop! Stop! cried all her nerves, wailing along the surface of her skin. The coats that covered them were torn off and they shuddered like naked people screaming, Stop! Stop!
Wenn die Gänsehaut wieder weg ist, fallen die vielen dunklen Vokale auf, die das unangenehme, dunkle Gefühl nachahmen, und die Plosivlaute, die den Schrecken unterstreichen. Der wiederholte [o]-Laut ahmt vielleicht die Form eines Paars Lippen nach, die voller Angst „Stop! Stop!“ rufen.
Einen hab ich noch: „Her strapped ankles arched angrily; her wrists strained against their bracelets.“
Out onto the poetic verges of metaphor
Stafford setzt natürlich auch Metaphern ein, um den Schmerz zu beschreiben. Hulbert in ihrer Biografie meint, sie versuche sogar, die poetischen Grenzen der Metapher zu erreichen („venturing out onto the poetic verges of metaphor“).
Oft helfen Naturphänomene: Pansys Schmerz ist ein „wild fire [running] through all the convolutions to fill with flame the small sockets and ravines“, eine „tidal wave driven by a hurricane, […] lashing and roaring“, bis der Schmerz wieder abklingt und die Naturbeschreibung mit „calm weather“ abgeschlossen wird. Auch Personifizierungen sind zu finden, beispielsweise wird der Schmerz als „the demon, pain, which skulked in a thousand guises within her head“ beschrieben, und bei dem Ausdruck „the pain dug up the unmapped regions of her head with mattocks“ sieht man eine ganze Mannschaft dämonischer Geografen oder Archäologen vor sich, die in Pansys Kopf aktiv sind.
Die quälende Intensität dieser Empfindungen wird noch einmal übertroffen, was dazu führt, dass die Metaphern deutlich angestrengter und hilfloser wirken als zuvor: „The pain was a pyramid made of diamond; it was an intense light; it was the hottest fire, the coldest chill, the highest peak, the fastest force, the furthest reach, the newest time“. Diese reine Aufzählung zeigt, dass Pansy mühsam versucht, noch einmal Extreme zu finden, um ihre Gefühle auszudrücken. Schließlich kommt es sogar so weit, dass sie, wie oben schon zitiert, jeglichen Beschreibungsversuch aufgeben muss: „In such pain as passed all language and even the farthest fetched analogies […]“.
Das Großartige ist, dass der Text trotz all der sprachlichen Mittel nicht aufdringlich oder zusammengebastelt wirkt. Ich habe ihn für die Masterarbeit so intensiv analysiert, dass er vor Kringeln und Kästchen, roten und grünen und blauen Unterstreichungen nur so wimmelt, sodass seine Dichte schon auf den ersten Blick deutlich wird. Allerdings nur auf einer Kopie. In der Buchausgabe fließt er weiter unauffällig dahin, zeigt sich ganz ohne Markierungen und bleibt ein kleines Meisterwerk.
***
Quellen:
Goodman, Charlotte Margolis: Jean Stafford – The Savage Heart, Austin 1990.
Hulbert, Ann: The Interior Castle – The Art and Life of Jean Stafford, New York 1992.
Stafford, Jean: The Collected Stories, New York 2005.
St. Teresa of Avila: The Interior Castle, New York 2003.