„Eine Kunst des Möglichen“
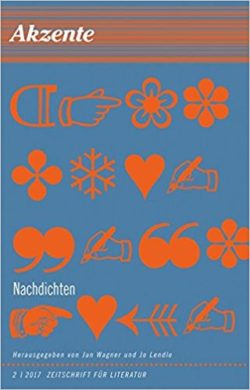 Letzte Woche hatte ich zwei ganz unterschiedliche Bücher in der Post, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Übersetzen und Dolmetschen beschäftigen. Das erste war der Roman Reibungsverluste von Mascha Dabić, zu dem ich neulich noch ein Interview verlinkt habe, der mich in seiner Belanglosigkeit und mit seinem fehlenden Spannungsbogen aber so geärgert hat, dass ich ihn genervt zur Seite gelegt habe. Das zweite Buch ist die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente, die sich mit dem Nachdichten, also dem Übersetzen von Lyrik beschäftigt.
Letzte Woche hatte ich zwei ganz unterschiedliche Bücher in der Post, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Übersetzen und Dolmetschen beschäftigen. Das erste war der Roman Reibungsverluste von Mascha Dabić, zu dem ich neulich noch ein Interview verlinkt habe, der mich in seiner Belanglosigkeit und mit seinem fehlenden Spannungsbogen aber so geärgert hat, dass ich ihn genervt zur Seite gelegt habe. Das zweite Buch ist die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente, die sich mit dem Nachdichten, also dem Übersetzen von Lyrik beschäftigt.
Dieses Mal hat Jo Lendle sich Jan Wagner als Mitherausgeber ausgesucht, und besser hätte es nicht kommen können. Im Vorwort erläutern sie, dass sie eine Reihe von Übersetzerinnen und Übersetzer (die meist gleichzeitig selbst Dichterinnen und Dichter sind) gebeten haben, einen Werkstattbericht über ihre aktuelle Arbeit zu schreiben und das Gedicht, das sie übersetzen, in der Originalversion, einer Roh-/Interlinearversion und der vorerst fertig übersetzten Version zu schicken. Außerdem erwähnen sie, wie gut ihre Auswahl zeige, aus wie vielen Sprachen derzeit in Deutschland übersetzt wird, aber da von vierzehn Texten mal wieder sechs englisch sind, drei russisch und zwei französisch, überzeugt mich das nicht sonderlich.
Die ganz konkreten Berichte über die bearbeiteten Gedichte sind spannend zu lesen, all die syntaktischen, semantischen, lexikalischen, kulturellen Kleinigkeiten, die berücksichtigt werden müssen, all die großen Ziele, die bei all der Pingelei nicht aus den Augen verloren werden dürfen. Und jetzt widerspreche ich mir, wenn ich sage, dass das besonders bei den Sprachen interessant ist, die ich selbst verstehe, denn gerade habe ich mich doch noch über die großzügige englische und französische Auswahl beschwert … Aber dem zum Trotz faszinieren vor allem die Erklärungen aus dem Chinesischen, das mir so schwierig – so anders – scheint, dass es ein Wunder ist, dass man so etwas überhaupt übersetzen kann, wie Lea Schneider es ganz offensichtlich mit Sun Wenbo getan hat.
Ebenso regen die allgemeineren Aussagen zum Dichten, Nachdichten und Übersetzen zum Nachdenken an. Viele der Nachdichterinnen und Nachdichter haben die gleichen Probleme:
„Gehe ich beim Übersetzen vom Eigenen aus oder vom Anderen?“ (Mirko Bonné) – „Als Übersetzerin bin ich zuallererst der Autorin verpflichtet – in diesem Sinne darf mein primäres Interesse kein philologisches sein.“ (Lea Schneider)
„Warum also immer von Verlust sprechen, wenn es ans Übersetzen von Lyrik geht? Ich füge hinzu!“ / „Ist Übersetzung eine Frage der Buchhaltung?“ (Odile Kennel) – „Wo etwas verloren gehen kann, kann fast immer auch etwas gewonnen werden.“ (Hendrik Jackson)
Lost in translation?
Gerade dieses Thema des Verlorengehens hat man bei Lyrik immer im Kopf. Dass so einfach etwas hinzugefügt wird – nein, nicht „so einfach“ natürlich, sondern nach langem, abwägendem Nachdenken –, ist für mich, die beim Übersetzen nur mit Prosa zu tun hat, erst einmal als Schock, und als eine dieser „Traditionalisten“ (Hendrik Jackson) frage ich mich, ob es legitim (Gruß an Andrea) sein kann, aus einem chinesischen Sprichwort ein deutsches zu machen und von Rom oder dem Elsass zu sprechen, ob es funktionieren kann, ein Gedicht übers Zeitunglesen zu modernisieren und ein Smartphone draus zu machen.
Auch nach dieser Lektüre bin ich mir nicht sicher, ob ich es für legitim halte, ob es für mich funktioniert. Die Nachdichterinnen und Nachdichter jedoch … nein, auch sie sind sich nicht immer sicher. Denn das Selbstbewusstsein, das bei den oben aufgeführten Zitaten durchscheint, wird auch immer wieder gebrochen. So viele Möglichkeiten es gibt, sich einem Gedicht anzunähern, so gibt es auch die fünfte und letzte Möglichkeit, „und nicht selten am besten: Ich kann es bleiben lassen.“ (Mirko Bonné) – „[D]enn entweder findet man einen solchen Ton, und zwar möglichst schon mit dem ersten Vers, oder man findet ihn nicht, und dann ist alles Suchen auch vergebens.“ (Norbert Hummelt) – „Sie stellen so große Anforderungen, dass ich von vornherein kapitulierte.“ / „Doch die Defizite zehren und zermürben, und ich finde mich wieder in der Ambivalenz eines Dazwischen, unfroh ‚lost in translation‘.“ (Ilma Rakusa)
Dennoch: Die vorläufigen bis endgültigen Varianten in diesem Band zeigen Zuversicht – „diese Gedichte eines Tages so zu übersetzen, wie sie es verdienen“ (Ernest Wichner) – und dass man vieles ausprobieren kann, bevor man tatsächlich scheitert.
—
Bildnachweis: hanser-literaturverlage.de